Transkriptionsregeln meistern mit Abtipper: Ihr Wegweiser für präzise Textumwandlung
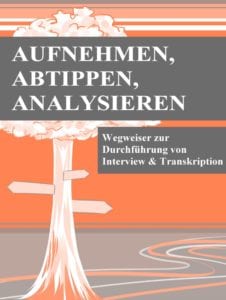 Dieser Artikel ist ein Ausschnitt aus unserem eBook Aufnehmen, Abtippen, Analysieren – Wegweiser zur Durchführung von Interview & Transkription.
Dieser Artikel ist ein Ausschnitt aus unserem eBook Aufnehmen, Abtippen, Analysieren – Wegweiser zur Durchführung von Interview & Transkription.
Das Buch gibt es als kostenloser Download: Jetzt alles zu Transkription & Co erfahren!
Inhaltsverzeichnis dieses Artikels

Was sind Transkriptionsregeln?
Transkriptionsregeln sind Regeln, die bei der Transkription von gesprochener Sprache befolgt werden, um die Transkription onsistent und verständlich zu gestalten.
Wussten Sie, dass die Wahl der richtigen Transkriptionsregeln entscheidend für die Qualität Ihrer Textdokumente sein kann? Ob in der akademischen Forschung, im Journalismus oder in der Marktforschung – die präzise Umwandlung von gesprochener Sprache in schriftliche Form hängt maßgeblich von den angewendeten Transkriptionsstandards ab. In diesem Abschnitt beleuchten wir verschiedene Transkriptionsregeln, wie die nach Mayring, Kuckartz und Dresing & Pehl, und deren spezifische Anwendungsbereiche, um Ihnen zu zeigen, wie Abtipper Ihnen dabei helfen kann, diese Herausforderung meisterhaft zu bewältigen.
Transkriptionsregeln Mayring: Präzision in der qualitativen Forschung
Die Transkriptionsregeln nach Mayring sind ein unverzichtbares Instrument in der qualitativen Forschung. Sie ermöglichen es Forschern, gesprochene Sprache präzise und inhaltsgetreu in Textform zu überführen. Dieser Ansatz ist besonders vorteilhaft, da er die Tiefe und den Kontext der gesammelten Daten bewahrt und eine gründliche Inhaltsanalyse erleichtert. Die Anwendung der Mayring-Regeln fördert die Genauigkeit und Integrität qualitativer Studien, indem sie eine strukturierte und systematische Textumwandlung gewährleistet, die essentiell für die Glaubwürdigkeit und Validität der Forschungsergebnisse ist.
Kuckartz Transkriptionsregeln: Optimierung der Datenanalyse
Kuckartz Transkriptionsregeln sind darauf ausgerichtet, die Datenanalyse zu optimieren. Sie bieten eine flexible Struktur, die es ermöglicht, die Transkripte an die spezifischen Bedürfnisse der Datenanalyse anzupassen. Diese Flexibilität ist besonders vorteilhaft in Forschungsprojekten, wo eine schnelle und zugleich tiefgehende Analyse von Daten erforderlich ist. Die Kuckartz-Regeln erleichtern eine effiziente Auswertung, da sie eine klare und übersichtliche Darstellung der gesprochenen Inhalte bieten, wodurch Forscher:innen wichtige Informationen schnell identifizieren und analysieren können. Dies verbessert sowohl die Effizienz als auch die Genauigkeit in der Datenanalyse.
Dresing und Pehl Transkriptionsregeln: Vereinfachung komplexer Inhalte
Die Transkriptionsregeln von Dresing und Pehl spielen eine entscheidende Rolle bei der Vereinfachung komplexer Inhalte. Diese Regeln sind speziell für Projekte konzipiert, bei denen Klarheit und Struktur im Vordergrund stehen.
Strukturierte Darstellung
Durch den Verzicht auf unnötige Details und die Konzentration auf das Wesentliche, ermöglichen diese Regeln eine übersichtliche Darstellung von Gesprächen. Diese klare Strukturierung ist besonders hilfreich bei der Analyse dichter und komplexer Diskussionen.
Fokus auf Schlüsselelemente
Die Konzentration auf Schlüsselelemente der Kommunikation erleichtert die Interpretation der Inhalte. Dies ist besonders nützlich in Forschungs- und Analysekontexten, wo die präzise Erfassung von Informationen unerlässlich ist.
Spezifische Anpassung
Von Mayring bis Kuckartz und Dresing & Pehl passen wir unsere Methoden an die spezifischen Anforderungen jedes Projekts an. Wir bieten personalisierte Lösungen, um präzise und effiziente Transkriptionen zu liefern.
Transkriptionsverfahren unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Komplexität – einzelne Aspekte sind optional.
Transkriptionsregeln Mayring: Präzision in der qualitativen Forschung
Die Transkriptionsregeln nach Mayring sind ein unverzichtbares Instrument in der qualitativen Forschung. Sie ermöglichen es Forschern, gesprochene Sprache präzise und inhaltsgetreu in Textform zu überführen. Dieser Ansatz ist besonders vorteilhaft, da er die Tiefe und den Kontext der gesammelten Daten bewahrt und eine gründliche Inhaltsanalyse erleichtert. Die Anwendung der Mayring-Regeln fördert die Genauigkeit und Integrität qualitativer Studien, indem sie eine strukturierte und systematische Textumwandlung gewährleistet, die essentiell für die Glaubwürdigkeit und Validität der Forschungsergebnisse ist.
Kuckartz Transkriptionsregeln: Optimierung der Datenanalyse
Kuckartz Transkriptionsregeln sind darauf ausgerichtet, die Datenanalyse zu optimieren. Sie bieten eine flexible Struktur, die es ermöglicht, die Transkripte an die spezifischen Bedürfnisse der Datenanalyse anzupassen. Diese Flexibilität ist besonders vorteilhaft in Forschungsprojekten, wo eine schnelle und zugleich tiefgehende Analyse von Daten erforderlich ist. Die Kuckartz-Regeln erleichtern eine effiziente Auswertung, da sie eine klare und übersichtliche Darstellung der gesprochenen Inhalte bieten, wodurch Forscher:innen wichtige Informationen schnell identifizieren und analysieren können. Dies verbessert sowohl die Effizienz als auch die Genauigkeit in der Datenanalyse.
Dresing und Pehl Transkriptionsregeln: Vereinfachung komplexer Inhalte
Die Transkriptionsregeln von Dresing und Pehl spielen eine entscheidende Rolle bei der Vereinfachung komplexer Inhalte. Diese Regeln sind speziell für Projekte konzipiert, bei denen Klarheit und Struktur im Vordergrund stehen.
Strukturierte Darstellung
Durch den Verzicht auf unnötige Details und die Konzentration auf das Wesentliche, ermöglichen diese Regeln eine übersichtliche Darstellung von Gesprächen. Diese klare Strukturierung ist besonders hilfreich bei der Analyse dichter und komplexer Diskussionen.
Fokus auf Schlüsselelemente
Die Konzentration auf Schlüsselelemente der Kommunikation erleichtert die Interpretation der Inhalte. Dies ist besonders nützlich in Forschungs- und Analysekontexten, wo die präzise Erfassung von Informationen unerlässlich ist.
Spezifische Anpassung
Von Mayring bis Kuckartz und Dresing & Pehl passen wir unsere Methoden an die spezifischen Anforderungen jedes Projekts an. Wir bieten personalisierte Lösungen, um präzise und effiziente Transkriptionen zu liefern.
Regeln von abtipper.de
Aufgrund jahrelanger Erfahrung haben wir von abtipper unsere eigenen Transkriptionsregeln, nach einfachen und erweiterten Verfahren, entwickelt.
Allgemeine Richtlinien
(gültig für einfache, wissenschaftliche und erweiterte Transkription)
Sprecherbezeichnung und -wechsel
- Falls Teil des Auftrags, werden nach jedem Sprecherwechsel Zeitstempel im Format #hh:mm:ss-m# eingefügt.
- Jeder Sprecher bzw. jede Sprecherin erhält bei einem Wechsel einen eigenen Absatz. Auch kurze Zwischenrufe werden in separaten Absätzen transkribiert.
- Die Person, die das Interview führt, wird als „I“ bezeichnet, während die befragte Person als „B“ gekennzeichnet wird. Bei mehreren Interviewenden oder befragten Personen werden diese fortlaufend nummeriert: I1, I2, I3 bzw. B1, B2, B3 usw.
- In Gruppengesprächen ohne Interviewer wird jede Person als B1, B2 nummeriert.
Fremdsprachen
- Fremdsprachliche Begriffe werden entsprechend den Regeln der deutschen Rechtschreibung und Morphologie angepasst.
- Fremdsprachige Abschnitte werden mit dem Hinweis „(Fremdsprache)“
Gendern
- Wenn in der Audiodatei hörbar gegendert wird, erfolgt die Kennzeichnung durch den Asterisk (Gendersternchen) genutzt, z. B. Zuschauer*innen, Lehrer*innen.
Anonymisierung
Wir bieten gerne eine kostenfreie Anonymisierung Ihrer Transkription an. Dies bedeutet, dass Informationen, die Rückschlüsse auf bestimmte Personen zulassen, anonymisiert werden.
- Namen von Personen werden durch [Person], Orte durch [Ort] und Organisationen bzw. Firmen durch [Organisation]
- Auch Geburtstage, E-Mail-Adressen und Telefonnummern werden anonymisiert.
- Bei mehreren Personen, Orten oder Organisationen werden diese entsprechend nummeriert, z. B. [Person 1], [Person 2]
Einfache und Wissenschaftliche Transkriptionsregeln
Für viele Zwecke ist eine Transkription nach einfachen Regeln das geeignetste Verfahren. Dies gilt insbesondere, wenn der Inhalt bei der Analyse im Vordergrund steht, z.B. bei Interviews für die Öffentlichkeit, wie Presse oder Film und Fernsehen, aber auch für wissenschaftliche Fragestellungen außerhalb der Sprachwissenschaft, wie Wirtschaft oder Marktforschung. Eine Transkription, die mit einem einfachen Verfahren erstellt wurde, ist zudem leicht geglättet, das heißt Stotterer, Versprecher und Zwischenlaute wie „äh“ und „ähm“ werden nicht berücksichtigt. Dialektale Äußerungen werden außerdem in Standardsprache wiedergegeben. Dies führt dazu, dass das Transkript gut leserlich ist und an die Öffentlichkeit weitergegeben werden kann, damit beispielsweise Interviews auf Onlineseiten oder in Printmedien veröffentlicht werden können.
Einfache Verfahren empfehlen sich, wenn inhaltliche Aspekte im Vordergrund stehen – das Transkript wird leicht geglättet und ist damit besonders gut, auch für die Öffentlichkeit, zugänglich
Eine wissenschaftliche Transkription wird nach den Regeln der einfachen Transkription bearbeitet und zusätzlich von einem Lektor überprüft. Dies bietet sich vor allem für Abschlussarbeiten an.
Bei der wissenschaftlichen Transkription wird das Transkript zusätzlich von einem Lektor geprüft.
Allgemeines
Es wird wörtlich transkribiert, also weder lautsprachlich noch zusammenfassend. Es werden alle Aussagen transkribiert, auch scheinbar unwichtige Füllwörter. Nicht inhaltsrelevante Elemente wie Dialekt, Stotterer, Ähms und Hms werden leicht geglättet.
Grammatik
- Die Wortstellung wird beibehalten und es wird keine Korrektur grammatikalischer Fehler vorgenommen.
- Ausnahme: Bei Sprecher*innen mit gebrochenem Deutsch werden die Artikel und Fälle zur besseren Lesbarkeit korrigiert.
Lexikalische Anpassungen
- Wortdoppelungen werden nur dann notiert, wenn sie als Stilmittel genutzt werden. Ungewollte Wortwiederholungen werden geglättet.
- Rückfragende Partikel wie „ne?“ oder „gell?“ werden notiert
- Verständnissignale werden nur dann transkribiert, wenn sie Zustimmung signalisieren („Stimmt“, „Genau“).
- „Hm“ wird nur transkribiert, wenn es von inhaltlicher Bedeutung ist.
Zum Beispiel:
– als alleinige Antwort auf eine Frage als „Hm (bejahend)“ oder „Hm (verneinend)“.
– als Frage „Hm?” im Sinne von „Wie bitte?“ - Wortverschleifungen wie „hamma“ werden an das Schriftdeutsche angepasst („haben wir“)
Überlappungen und Pausen
- Längere Pausen ab ca. 3 Sekunden werden durch drei Auslassungspunkte in Klammern (…) gekennzeichnet.
- Einwürfe werden nur transkribiert, wenn sie von inhaltlicher Bedeutung sind.
- Überlappungen durch Aussagen mehrerer Sprechenden zur selben Zeit werden geglättet und in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht.
Wort-, Satzabbrüche und elliptische Sätze
- Abgebrochene Wörter und Stottern werden geglättet oder ausgelassen.
- Abgebrochene Sätze werden durch das Abbruchzeichen / gekennzeichnet, wobei davor ein Leerzeichen, danach kein Satzzeichen genutzt wird.
- Elliptische Sätze werden so übernommen, wie sie gesprochen wurden.
Nicht oder schwerverständliche Wörter und Passagen
- Nicht verständliche Wörter werden mit (unv. #hh:mm:ss-m#)
- Längere unverständliche Passagen werden ebenfalls mit (unv. #hh:mm:ss-m#) gekennzeichnet, jedoch möglichst unter Angabe der Ursache, z. B. (unv., Verkehrslärm #00:10:01-1#).
- Schwer verständliche oder vermutete Wörter werden in runden Klammern notiert und mit einem Fragezeichen sowie einer Zeitmarke versehen, z. B. (Aerobic? #00:15:34-0#).
- Für die Zeitmarken gilt: Wenn innerhalb eine Minute bereits eine Zeitmarke gesetzt wurde, wird die nächste Zeitmarke weggelassen. Sollte innerhalb einer Minute noch keine Zeitmarke angegeben sein, wird diese notiert.
Dialekt, Umgangssprache und Betonungen
- Umgangssprachliche Ausdrücke werden unverändert übernommen.
- Dialektausdrücke werden im Allgemeinen wortgetreu ins Hochdeutsche übersetzt. Ausgenommen hiervon sind Wörter, bei denen eine klare Übersetzung nicht möglich ist. (z.B. „Fritz ist ein totaler Gloifel.“)
- Betonte Wörter oder Passagen werden nicht hervorgehoben.
Nonverbale Äußerungen und Geräusche
- Lachen und Weinen werden in runden Klammern notiert, wenn sie eine wesentliche Bedeutung haben oder sehr präsent sind.
- Andere Geräusche oder nonverbale Äußerungen bleiben unberücksichtigt.
Beispiel für ein Transkript nach einfachen Transkriptionsregeln:
Mix Aufnahme 1.mp3
I1: Guten Tag, Herr Bäcker. #00:00:03-0#
I2: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben. #00:00:06-0#
B: Sehr gerne, ich freue mich darauf. #00:00:09-0#
I1: Okay, dann lassen Sie uns doch direkt einsteigen. Wie sieht denn Ihr typischer Berufsalltag aus? #00:00:15-0#
B: Also ich arbeite als Marketing-Spezialist in einem kleinen Unternehmen. Und ein Tag beginnt oft damit, dass ich meine Mails antworte, die sortiere und die Aufgaben organisiere. Und dann laufe ich meistens von Meeting zu Meeting und bespreche angehende Projekte. #00:00:35-0#
I1: Okay, das klingt sehr interessant und auf jeden Fall nach einer abwechslungsreichen Arbeit. Wie gehen Sie denn bei der Jobsuche vor, wenn Sie da eine Veränderung in Erwägung ziehen würden? #00:00:46-0#
B: Jobsuche kann manchmal ziemlich herausfordernd (unv. #00:00:49-0#), recherchiere oft online nach, gucke mir irgendwelche Stellenangebote an. Aber ich finde, persönliche Kontakte sind da auch sehr wichtig, gerade Networking ist entscheidend. Man lernt oft von anderen und kann so vielleicht auch auf Stellenangebote stoßen, die nicht (öffentlich?) ausgeschrieben sind. #00:01:08-0#
Erweiterte Transkriptionsregeln
Erweiterte Verfahren eignen sich vor allem, wenn eine detaillierte Auswertung erfolgen soll, bei der neben inhaltlichen Aspekten auch sprachliche Aspekte berücksichtigt werden sollen. Dazu zählen u.a. besondere verbale Aspekte, wie z.B. Stotterer, sowie auch prosodische Aspekte (besondere Betonungen). Damit ist die Transkription nach dem erweiterten Verfahren aufwändiger als nach einfachen Regeln. Gleichzeitig wird die Lesbarkeit des Transkriptes für Außenstehende erschwert, sodass das erweiterte Verfahren nur in wenigen Anwendungsfällen besser geeignet ist.
Bei erweiterten Verfahren werden auch sprachliche Aspekte berücksichtigt, dadurch ist die Transkription aufwändiger – erweiterte Verfahren empfehlen sich nur in seltenen Fällen.
Allgemeines
Bei der erweiterten Transkription wird wörtlich transkribiert, also weder lautsprachlich noch zusammenfassend. Es werden alle Aussagen transkribiert, auch scheinbar unwichtige Füllwörter und Fülllaute (z.B. “äh”, “hm”, “puh”).
Grammatik
- Die Wortstellung wird beibehalten und es wird keine Korrektur grammatikalischer Fehler vorgenommen.
- Ausnahme: Bei Sprecher*innen mit gebrochenem Deutsch werden die Artikel und Fälle zur besseren Lesbarkeit
Lexikalische Anpassungen
- Wortdoppelungen werden immer notiert.
- Rückfragende Partikel wie „ne?“ oder „gell?“ werden notiert.
- Verständnissignale werden immer transkribiert, z. B. „Ja“, „Aha“, „Ach so“.
- „Hm“ wird immer dann notiert, wenn es sich nicht mit einer anderen Aussage überlappt. Dabei wird es in runden Klammern immer mit einer Deutung versehen, z. „Hm (verneinend).“, „Hm (zögernd).“
- Wortverschleifungen wie „hamma“ werden an das Schriftdeutsche angepasst („haben wir“).
Überlappungen und Pausen
- Pausen werden durch in Klammern gesetzte Auslassungspunkte markiert: (.) steht für ca. 1 Sekunde Pause, (..) für ca. 2 Sekunden, (…) für ca. 3 Sekunden. Dauert die Pause länger als 3 Sekunden, wird die Zahl in Klammern gesetzt, z. B. (7) für 7 Sekunden Pause.
- Einwürfe werden in einem separaten Absatz transkribiert.
- Überlappungen durch Aussagen mehrerer Sprechenden zur selben Zeit werden durch // mit einem Leerzeichen davor und dahinter Beispiel: Es wurde „werden“ und „Du probst?“ gleichzeitig gesprochen, also:
B: Sowas muss vernünftig geprobt // werden. #00:01:42-6#
I: Du probst? // Das gibt es doch gar nicht. #00:01:43-8#
Wort-, Satzabbrüche und elliptische Sätze
- Abgebrochene Wörter und Sätze werden mit dem Abbruchzeichen „/“ gekennzeichnet.
Nicht oder schwerverständliche Wörter und Passagen
- Wörter, die unverständlich sind, werden als solche gekennzeichnet und mit einem Zeitstempel versehen, z. B. (unv. #hh:mm:ss-m#).
- Längere unverständliche Passagen werden ebenfalls mit (unv. #hh:mm:ss-m#) gekennzeichnet, jedoch möglichst unter Angabe der Ursache, z. B. (unv., Verkehrslärm #00:10:01-1#).
- Schwer verständliche oder vermutete Wörter werden in runden Klammern notiert und mit einem Fragezeichen sowie einem Zeitstempel markiert,
B. (Journalist? #01:07:34-9#). - Wenn innerhalb einer Minute bereits eine unverständliche mit einem Zeitstempel markiert wurde, wird die nächste unverständliche Stelle innerhalb dieser Minute nicht markiert.
Dialekt, Umgangssprache und Betonungen
- Umgangssprachliche Ausdrücke werden unverändert übernommen.
- Die Syntax wird im Dialekt beibehalten, lediglich dialektal bedingte doppelte Verneinungen werden geglättet.
- Dialektausdrücke werden im Allgemeinen wortgetreu ins Hochdeutsche übersetzt. Ausgenommen hiervon sind Wörter, bei denen eine klare Übersetzung nicht möglich ist. (z.B. „Fritz ist ein totaler Gloifel.“)
- Betonte Wörter oder Passagen werden durch VERSALIEN hervorgehoben.
Nonverbale Äußerungen und Geräusche
- Emotionale nonverbale Äußerungen aller Sprechenden, welche die Aussage unterstützen oder verdeutlichen, werden bei Einsatz in Klammern notiert. z.B.: (lacht), (seufzt).
- Alle nonverbalen Aktionen (z. B. Geräusche), die das Gespräch unterbrechen, werden transkribiert. Falls diese Unterbrechung länger als 10 Sekunden andauert, wird die Länge mit angegeben, z. B. (Kinderstimme im Hintergrund, 10 Sek.).
Beispiel für ein Transkript nach erweiterten Transkriptionsregeln:
Mix Aufnahme 1.mp3
I1: (Wählton) Guten Tag, Herr Bäcker. #00:00:03-0#
I2: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für (.) das Gespräch genommen haben. #00:00:06-0#
B: Äh sehr gerne, ich freue mich drauf. #00:00:09-0#
I1: Okay, dann lassen Sie uns doch direkt einsteigen. Wie sieht denn Ihr typischer Berufsalltag aus? #00:00:15-0#
B: (.) Ähm also ich arbeite als Marketing-Spezialist in einem kleinen Unternehmen. (.) // Und ähm #00:00:20-0#
I2: (hustet) // Entschuldigung. #00:00:20-0#
B: ein TAG beginnt oft damit, dass ich meine Mails antworte, äh die sortiere und die Aufgaben organisiere. Und dann laufe ich meistens von Meeting zu Meeting und bespreche (.) angehende Projekte. #00:00:35-0#
I1: (.) Okay, das klingt äh sehr interessant und auf jeden Fall nach einer abwechslungsreichen Arbeit. Ähm wie gehen Sie denn bei der JOBSUCHE vor, wenn Sie da eine Veränderung in Erwägung ziehen würden? #00:00:46-0#
B: Jobsuche kann (.) manchmal ziemlich herausfordernd (unv. #00:00:49-0#) recherchiere oft online nach, gucke mir irgendwelche Stellenan/ Stellenangebote an. Aber ich finde, persönliche Kontakte sind da auch sehr wichtig, ähm gerade Networking ist entscheidend. Man lernt oft von anderen und ähm kann so vielleicht auch auf Stellenangebote stoßen, die NICHT (öffentlich?) ausgeschrieben sind. #00:01:06-0#
I2: Ja. #00:01:07-0#
I1: Hm (bejahend). #00:01:08-0#
Komplexe Transkriptionsregeln
Zu den komplexen Verfahren gehören neben weiteren TiQ, HIAT und GAT2. Diese Verfahren sind so komplex, dass sie üblicherweise nur in den Sozialwissenschaften und der Linguistik genutzt werden. Somit kommen sie nur in ganz spezifischen Anwendungsfeldern zum Einsatz.
Komplexe Verfahren können unterschiedliche Schwerpunkte haben. Diese liegen nicht nur, wie bei der einfachen und erweiterten Transkription, auf inhaltlichen und verbalen Aspekten. Berücksichtigt wird besonders die exakte Wiedergabe des Gesagten. Dabei werden auch nonverbale sowie prosodische Merkmale berücksichtigt. Die komplexen Verfahren sind dazu geeignet, beim Lesen des Transkriptes einen Höreindruck zu gewinnen. Je mehr Parameter gesetzt werden, desto mehr kann analysiert und auch interpretiert werden, dementsprechend ist die Analyse bei komplexen Verfahren aufwändiger und nimmt mehr Zeit in Anspruch.
Komplexe Verfahren kommen nur in ganz spezifischen Anwendungsfeldern zum Einsatz – u.a. dienen sie dazu einen Höreindruck zu vermitteln
Ein bekanntes komplexes Verfahren ist das TIQ Verfahren. Das TiQ Verfahren (nach Bohnsack) ist vor allem auf soziologische Forschungsfragen ausgerichtet. Im Vergleich zu HIAT und GAT2 ist das TiQ Verfahren leichter zugänglich (Grund dafür ist auch die Darstellung). Für die sprachwissenschaftliche Forschung ist TiQ allerdings nicht geeignet.
TiQ Transkriptionsregeln
- Buchstäbliche Transkription; Zwischenlaute, Hörerbestätigungen („äh“, „hm“ usw.) und emotionale Äußerungen („lachen“) werden übernommen
- Wörter werden zu Beginn der Äußerung und zu Beginn einer Überlappung, nach einem └ , groß geschrieben. Nach Satzzeichen wird jedoch klein geschrieben, da die Satzzeichen intonatorisch zu verstehen und nicht grammatikalischer Natur sind. Eine Ausnahme bilden auch Substantive, diese werden ebenfalls großgeschrieben.
- Zeilen werden nummeriert
- Allen Teilnehmern wird ein Buchstabe mit dem Zusatz f für weibliche Personen und m für männliche Personen zugewiesen (z.B.: Af, Bm, Cf).
Weitere Zeichen und Symbole im TiQ Verfahren:
- └ Beginn einer Überlappung
- ┘Ende einer Überlappung
- (.) Pause bis zu einer Sekunde
- (2) Anzahl der Sekunden einer Sprecherpause
- Betontes wird unterstrichen
- Lauter Gesagtes wird fett geschrieben
- °leises° Sprechen wird mit ° markiert
- . stark sinkende Intonation
- ; schwach sinkende Intonation
- ? stark steigende Intonation
- , schwach steigende Intonation
- – kennzeichnet Abbruch eines Wortes: lei-
- = markiert Wortverschleifungen: ham=ma
- : markiert Dehnung von Vokalen, die Häufigkeit entspricht der Länge der Dehnung z.B.: „nei::n“
Bei Unsicherheit bezüglich des genauen Wortlautes, wird das Wort in Klammern gesetzt, Bsp.: (doch)
() unverständliche Äußerungen, die Länge der Klammer entspricht in etwa der Dauer der unverständlichen Äußerung
((stöhnt)) Kommentare bzw. Anmerkungen zu parasprachlichen, nicht-verbalen oder gesprächsexternen Ereignissen; die Länge der Klammer entspricht im Falle der Kommentierung parasprachlicher Äußerungen (z.B. Stöhnen) etwa der Dauer der Äußerung.
@nein@ z.B. lachend gesprochenes „nein“
@(.)@ kurzes Auflachen
@(3)@ 3 Sekunden Lachen
//mhm// Hörersignal des Interviewers, wenn das „mhm“ nicht überlappend ist.
HIAT und GAT2 sind komplexe, individuell erweiterbare Verfahren, die vor allem im sprachwissenschaftlichen Bereich genutzt werden. Bei diesen Verfahren kann es sogar sinnvoll sein, mit Videomaterial zu arbeiten, da mit HIAT und GAT2 auch nonverale Kommunikation und non-verbales Handeln berücksichtigt werden.
Auch bei komplexen Verfahren kann es sinnvoll sein mit Videomaterial zu arbeiten – dadurch kann non-verbale Kommunikation analysiert werden
Das HIAT Verfahren hat einige Vorteile, insbesondere, wenn mehrere Sprecher gleichzeitig kommunizieren und wenn weitere prosodische Merkmale markiert werden sollen. Die Partiturschreibweise beeinträchtigt zwar die Lesbarkeit, jedoch erlaubt sie es, mehrere Aspekte anschaulich und eindeutig zu illustrieren.
Für komplexe Verfahren wie HIAT wird oft eine Partiturschreibweise vorgegeben – zur Darstellung empfiehlt sich ein entsprechendes Programm wie EXMARaLDA
Wenn die Transkription nach dem HIAT Verfahren erstellt werden soll, ist es daher ratsam, mit EXMARaLDA zu arbeiten. EXMARaLDA ist ein linguistisches System mit Tools zum Erstellen und Analysieren von Gesprächskorpora. Dazu gehört auch das Werkzeug Partitur-Editor zum Anfertigen von Transkripten. Nachfolgend ein Beispiel für die Darstellung als Partitur in EXMARaLDA:

Mit HIAT und GAT2 wird ein besserer Höreindruck vermittelt, dafür werden die Transkripte mit zunehmendem Umfang immer unleserlicher. Des Weiteren nehmen diese Verfahren mehr Zeit in Anspruch, da jeder Gesprächsausschnitt mehrmals auf unterschiedliche Phänomene (wie Pausen, Hauptakzente, Tonhöhenverläufe etc.) überprüft werden muss.
GAT2, ursprünglich GAT (Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem), wurde von Linguisten mit dem Ziel entwickelt, ein einheitliches System zu schaffen. Damit sollten Daten aus unterschiedlichen Forschungsrichtungen ausgewertet werden können. Die überarbeitete Version GAT2 existiert seit 2009.
GAT2 findet ebenfalls hauptsächlich Anwendung in der Linguistik – dabei wird zwischen Minimal-, Basis- und Feintranskript differenziert
Bei GAT2 wird zwischen drei Transkripten unterschieden, wobei diese beliebig miteinander kombiniert werden können: das Minimaltranskript, das Basistranskript und das Feintranskript.
Das Minimaltranskript enthält Informationen zur Verlaufsstruktur z.B. Überlappungen, simultanes Sprechen und Pausen.
Im Basistranskript werden Turns in Intonationsphrasen segmentiert, folgende Aspekte können dabei berücksichtigt werden:
- Tonhöhenbewegungen am Phrasenende (.,;-?)
- Fokusakzent und starker Akzent. Bsp.: ak!ZENT!
- Dehnung von Lauten
- interpretierende Kommentare wie <<lachend>wow> etc.
Im Feintranskript werden Nebenakzente, Akzenttonhöhenbewegungen, Tonhöhensprünge, Veränderung der Lautstärke/Geschwindigkeit etc. vermerkt. Das Feintranskript ist vor allem für Linguisten im Bereich der Konversationsanalyse/ Intonationsphonologie interessant.
Für das GAT2 Verfahren sollte eine äquidistante Schriftart (etwa Courier) verwendet werden, da dies Bedingung für die Weiterbearbeitung der Transkripte (z.B. bei simultan Gesprochenem) ist. Hier ein Beispiel für ein Minimaltranskript nach GAT2:

Eine detaillierte Schritt-für-Schritt Anleitung für die Transkription nach GAT2 stellen Hagemann/ Henle (2014) als PDF zur kostenlosen Verfügung. Außerdem gibt es ein Online Tutorial von der Universität Freiburg mit praktischen Hinweisen zum Transkribieren nach GAT2:
http://paul.igl.uni-freiburg.de/gat-to/
| Transkriptionsregeln | Übersicht Transkriptionsregeln | ||
| Einfache Regeln von abtipper |
Erweiterte Regeln von abtipper |
TIQ | |
| wortgenau (auch Fehler werden übernommen) | ja | ja | ja |
| Füllwörter (“sozusagen”, “ich sage mal”) | ja | ja | ja |
| Rezeptionssignale (z.B. „mhm” bejahend) | ja, wenn Antwort auf eine Frage | ja | ja |
| Häsitationsphänomene (z.B. “äh”, “ähm”) |
nein | ja | ja |
| Dialekt | Standarddeutsch (Ausnahme: Dialektale Wörter ohne akkurate Übersetzung) | Standarddeutsch (Ausnahme: Dialektale Wörter ohne akkurate Übersetzung) | wird übernommen |
| Wort- und Satzabbrüche | Satzabbrüche mit – | beides mit – | Wortabbruch mit – |
| Wortverschleifung (z.B.: „Ich hab’s” statt „ich habe es”) | Standarddeutsch (Ich habe es) | Standarddeutsch (Ich habe es) | mit = (Ich hab=s) |
| Interjektionen/Einwürfe (z.B.: „oh”, „ups”, „pst”) | nein | ja | ja |
| Sprechpausen | ab 4 Sekunden Anzahl der Sekunden in Klammern (5 Sek) | ab 4 Sekunden Anzahl der Sekunden in Klammern (5 Sek) | Pause bis zu einer Sekunde: (.); ansonsten Anzahl der Sekunden in Klammern (4) |
| Überlappungen | Einschübe (auch wenn überlappend) in Klammern: I: Das ist zwei Jahre (B: Nein!) her, ich erinnere mich | Einschübe (auch wenn überlappend) in Klammern: I: Das ist zwei Jahre (B: Nein!) her, ich erinnere mich | () Länge der Klammer entspricht der Dauer der unv. Aussage |
| kurze Einschübe | |||
| vermuteter Wortlaut | (?Wortlaut) | (?Wortlaut) | (Wortlaut) |
| unverständlicher Wortlaut | Markierung an exakter Stelle mit … und einem Zeitstempel |
Markierung an exakter Stelle mit … und einem Zeitstempel |
|
| wörtliche Rede | wird in Anführungszeichen gesetzt |
wird in Anführungszeichen gesetzt |
|
| Prosodie | |||
| starke Betonung | nein | in Großbuchstaben | Unterstreichung |
| laut/ leise gesprochen | nein | nein | lauter/ °leiser° |
| Dehnung eines Wortes | nein | nein | Deh::nung, Häufigkeit entspricht Länge der Dehnung |
| Intonation | nein | nein | durch Satzzeichen (.;,?) |
| Nonverbale Ereignisse (z.B.: Störgeräusche, Telefonklingeln) | in Klammern (Telefon klingelt) | in Klammern (Telefon klingelt) | in doppelten Klammern ((Telefon klingelt)) |
| Parasprachliche Ereignisse (z.B.: lachen, weinen etc.) | in Klammern (lachen) | in Klammern (lachen) | in doppelten Klammern ((weinen)), Ausnahme lachen mit @ Symbolen: @(.)@ kurzes Auflachen |
| Groß- und Kleinschreibung | entsprechend der deutschen Grammatik, Höflichkeitspronomina („Sie”, „Ihre”) beginnen mit einem Großbuchstaben | entsprechend der deutschen Grammatik, Höflichkeitspronomina („Sie”, „Ihre”) beginnen mit einem Großbuchstaben | bis auf Substantive wird alles kleingeschrieben |
| Satzzeichen | nach den offiziellen dt. Rechtschreibregeln, Bandwurmsätze werden gemieden | nach den offiziellen dt. Rechtschreibregeln, Bandwurmsätze werden gemieden | s. Intonation |
| Zeitstempel | Nur bei unverständlichem Wortlaut | nach jedem Sprecherwechsel und bei unverständlichem Wortlaut | k.A. |
Beauftragen Sie jetzt Ihre Transkription bei abtipper.de!
Transkriptionsregeln legen fest, nach welchen Vorgaben Audio- und Videoaufnahmen in Text überführt werden sollen. Sie bestimmen z.B. was wie notiert werden muss, was weggelassen werden kann und wie das fertige Transkript aussehen sollte.
Man unterscheidet typischerweise zwischen einfachen, erweiterten und komplexen Transkriptionsregeln. Die beiden letztgenannten finden dabei nahezu ausschließlich bei wissenschaftlichen Transkriptionen ihre Anwendung.
Einfache Transkriptionsregeln sind außerhalb der Wissenschaft der Standard. Sie legen eine wortwörtliche Transkription fest, erlauben es aber, nicht-inhaltsrelevante non-verbale Elemente (z.B. Stotterer) herauszulassen.
In den Sozialwissenschaften wird für eine Inhaltsanalyse oft auch mit einfachen Transkriptionsregeln gearbeitet. In den Sprachwissenschaften sind hingegen erweiterte oder komplexe Regeln üblich.
Erweiterte Transkriptionsregeln werden vor allem in den Sprachwissenschaften angewendet. Sie legen eine wortwörtliche Transkription inklusive aller non-verbalen Elemente (z.B. Stotterer) fest.
In den Sprachwissenschaften gibt es darüber hinaus eine Reihe von komplexen Transkriptionsregeln wie z.B. GAT2, HIAT oder TIQ, die teils sehr aufwändige und spezifische Vorgaben zur Transkription und Formatierung machen.
Außerhalb der Sprachwissenschaften ist die Anwendung dieser Verfahren eher unüblich, da die resultierenden Transkripte oft schwer lesbar sind und inhaltlich gegenüber dem Resultat der einfachen Transkriptionsregeln nur geringe Vorteile haben.